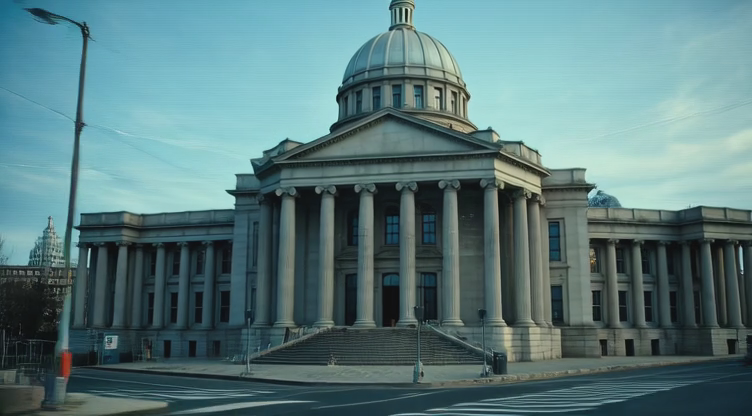Die neue Enge: Warum wir das Streiten verlernt haben
Zwischen israelischer Debattenlust und deutscher Kontaktschuld: Warum unsere Gesellschaft an hohlen Gesten und der Angst vor der falschen Schublade erstickt.

Gestern Abend gab es in meiner Familie ein Gespräch, das mir wieder einmal vor Augen führte, wie tief der Riss mittlerweile geht. Es war eine jener Diskussionen, die heute oft online geführt werden – in einem Raum, der eigentlich für Austausch gedacht war, aber immer mehr zur Arena der Unversöhnlichkeit wird. Es ging nicht mehr um Argumente, sondern um Etiketten. Wer nicht exakt die erwartete Haltung einnimmt, wird sofort aussortiert.
Diese private Erfahrung deckt sich eins zu eins mit dem, was mir eine jüdische Bekannte kürzlich schilderte. Sie ist 36, promovierte Akademikerin, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Heute lebt sie zwischen Deutschland und Israel. Ihre Diagnose über unser Land ist niederschmetternd: Sie empfindet das Leben hier zunehmend als geistiges Gefängnis.
Der Israel-Kontrast: Streit als Lebenselixier
„In Israel“, erzählte sie mir, „sitzen wir alle an einem Tisch. Der Linke, der Siedler, der Religiöse, der Säkulare. Wir schreien uns an, wir streiten bis aufs Messer, wir hören uns zu – und am Ende bleiben wir eine Gemeinschaft. Wir halten den Dissens aus, weil wir wissen, dass wir einander brauchen.“
Und in Deutschland? Hier erlebt sie das Gegenteil. Die Räume schließen sich. Ihr Kontaktkreis hat sich in den letzten drei Jahren fast nur noch auf enge jüdische Freundschaften beschränkt. Nicht aus Abkapselung, sondern weil das „Außen“ unerträglich geworden ist. Ein Umfeld, in dem man sich ständig prüfen muss: Darf ich das noch sagen? Wer hört mit? In welche Schublade werde ich gesteckt? In Israel findet sie die Freiheit des Wortes, die sie in Europa verloren glaubt.
Die Kultur der hohlen Gesten
Zu dieser Enge gesellt sich eine unerträgliche Oberflächlichkeit. Wir sind Weltmeister darin geworden, Teddybären an Tatorten abzulegen und Kerzen für die Kamera zu entzünden. Wir inszenieren unsere Betroffenheit wie ein Statussymbol.
„Das ist ja furchtbar!“, rufen die Leute, wenn Freunden etwas Schreckliches passiert. Sie bieten Hilfe an, solange das soziale Prestige es verlangt. Doch wenn die Hilfe wirklich gebraucht wird – wenn man gegen den Strom schwimmen oder sich für jemanden einsetzen müsste, der politisch „unbequem“ geworden ist –, dann herrscht Stille. Es ist eine „Ich bin dabei“-Kultur, die nichts kostet und nichts bewirkt. Es ist Heuchelei als gesellschaftlicher Kleber.
Kontaktschuld als Machtinstrument
Dass diese moralische Fassade sofort in Aggression umschlägt, sieht man am Umgang mit Menschen wie Theo Müller. Er hat es gewagt, mit der „falschen“ Person zu essen. Sofort rollt die Maschinerie der NGOs und Haltungs-Aktivisten. Es wird zur Distanzierung aufgerufen, als gäbe es eine religiöse Pflicht zur Ausgrenzung.
Hier schließt sich der Kreis zu dem Gespräch in meiner Familie: Wir haben die Fähigkeit verloren, das Gegenüber als Mensch zu sehen, wenn uns die Meinung nicht passt. Wir werfen lieber ein Stofftier an einen Tatort, als einem Freund oder Geschäftspartner beizustehen, der in die falsche Schublade geraten ist.
Ein Armutszeugnis für Europa
Dass eine deutsche Jüdin sagt, sie fühle sich heute eigentlich nur noch in Israel wirklich wohl, weil sie dort noch „echt“ sprechen kann, ist ein Alarmsignal. Wir haben die Substanz gegen die Pose getauscht. Wir zünden Kerzen an, aber wir lassen die Herzen derer kalt werden, die uns eigentlich nahestehen sollten.
Wir müssen aufhören, Betroffenheit zu simulieren, und wieder anfangen, einander auszuhalten. Wirkliche Toleranz zeigt sich nicht im Ablegen eines Stofftiers, sondern darin, am Tisch sitzen zu bleiben, wenn es schwierig wird.